Wie eine Depression entsteht und was sie im Kern ausmacht
01.02.2024 | Lesezeit 3 min
Die wichtigsten Merkmale einer Depression sind vielen bekannt: eine gedrückte Stimmung, keine Freude mehr an nichts, auch kein Interesse mehr an alten Lieblingsbeschäftigungen, Schlaf- und Appetitstörungen, keinerlei Antrieb. Oft zeigen sich auch ein vermindertes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, Angst vor der Zukunft oder Konzentrationsstörungen.
Hier soll es nun um die tieferen Merkmale einer Depression gehen. Um das, was aus Sicht der personzentrierten Psychotherapie das “Problem” ist und den Leidensdruck erzeugt.
Der Einfluss der Eltern
Dazu schauen wir uns zuerst einmal an, wie sich die Persönlichkeit eines depressiven Klienten in der Regel entwickelt. Hier wird nämlich schnell der Einfluss der Eltern deutlich: Sie haben häufig durch ihre Überfürsorglichkeit und Überängstlichkeit verhindert, dass sich ihr Kind zu einem selbstständigen und selbstsicheren Menschen entwickeln kann. Das “richtige” Verhalten zuhause bestand stattdessen oft darin, sich an die Regeln eines harmonischen und konfliktfreien Familienklimas anzupassen.
Noch häufiger aber gab es zuhause einen Mangel an Zuwendung, an bedingungsloser positiver Zuwendung und an Wertschätzung. Dieser Mangel führt einmal dazu, dass sich das Selbstvertrauen des Kindes nur gering entwickelt. Zum anderen führt dieser Mangel auch zu dem permanenten, fast unstillbaren Wunsch nach Nähe und positiver Beachtung – während das Kind gleichzeitig erlebt, beides nicht verdient zu haben.
Im Erwachsenenalter können bei diesen Kindern dann Verlusterlebnisse verschiedenster Art zuschlagen und sie völlig aus der Bahn werfen. Das kann der Verlust einer Beziehung, der Tod eines lieben Menschen oder der Verlust des Jobs sein. Solche Verlusterlebnisse können bei einem unter diesen Umständen aufgewachsenen Kind dann eine Abhängigkeit aktivieren. Also ein Gefühl, ohne das, was jetzt verloren gegangen ist, unvollständig und völlig wertlos zu sein.
Das Selbstbild depressiver Menschen
Als zweites schauen wir uns an, wie jemand mit einer Depression sich selbst sieht. Eine depressive Klientin hat in der Regel ein negatives Selbstbild von sich, ist extrem selbstkritisch, fühlt sich minderwertig und scheint sich selbst immer vor dem Hintergrund eines übertrieben hohen Idealbildes von sich selbst zu bewerten. Dieses oft unrealistisch hohe Selbstideal gibt dem ganzen Denken und Entscheiden einen tiefen, aber auch düsteren Lebensernst.
Die Neigung, sich selbst abzuwerten, wirkt wie ein verbissener Kampf gegen sich selbst. In den häufigen, fast vorwurfsvollen Klagen, dass die anderen sie nicht verstehen, liegt aber auch Verbitterung und Ärger gegen die engen Bezugspersonen. Diesen Ärger kann sich die depressive Klientin jedoch selten eingestehen – denn wenn der Ärger deutlich wird, ruft er oft unmittelbar Schuldgefühle hervor. Also unterdrückt sie den Ärger.
Die Sicht depressiver Klienten auf ihre Beziehungen
Und wie sieht es mit den Beziehungen aus, die depressive Klienten eingehen?
Depressive Klienten sind oft sehr vom Zuspruch und der Anerkennung anderer Menschen abhängig. Depressive sehen ihre Mitmenschen oft als überlegen an und scheinen ständig Kritik von ihnen zu erwarten. Weil sie eher konfliktscheu sind und nach Harmonie streben, können sie sich nicht gut abgrenzen. Um der befürchteten Kritik und Missachtung zu entgehen, versuchen sie, sich ständig anzupassen, sich den Beziehungserwartungen anderer unterzuordnen sowie ihre eigenen Erwartungen nur sehr indirekt zu äußern. Bei ihrem Partner rufen depressive Klienten aufgrund ihrer “Jammerigkeit” und ihres eher unterwürfigen Verhaltens manchmal Irritation, oft aber auch Ärger hervor.
Einerseits zeigen sich depressive Klienten in Beziehungen also eher demutsvoll und anpassungsfähig. Andererseits gibt es in ihrem Selbstkonzept Selbstbehauptungs-Tendenzen, die diese Klienten allerdings stark unterdrücken. Diese Ambivalenz zeigt sich dann auch in ihrem Bindungsverhalten, wo sie mal am Partner klammern und dann auch wieder die kalte Schulter zeigen.
Die Spannung, die in der Therapie aufgelöst werden muss
Bei depressiven Klienten besteht also eine Diskrepanz zwischen einem negativen Selbstbild, einem hohen Selbstideal und einer darauf beruhenden Anpassungsbereitschaft auf der einen Seite – und einem abgewehrten Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Autonomie und Selbstbehauptung auf der anderen Seite. Oder anders ausgedrückt: Es besteht eine Diskrepanz zwischen sich-klein-machen einerseits und groß-und-stark-sein-wollen andererseits.
Das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung wird abgewehrt, weil es dem depressiven Klienten Angst macht. Und warum macht es ihm Angst? Wenn er dieses Bedürfnis durchsetzt, so empfindet er, wird dies seine Beziehungen gefährden und die wohlwollende Beachtung von anderen. Wenn dann aber Lebensereignisse stattfinden, die solche Autonomie-Tendenzen herausfordern und an den Rand des Bewusstseins bringen (wie etwa ein beruflicher Aufstieg oder die Erkrankung des Partners), führt das zu einer akuten Spannung – und möglicherweise zum Auftreten von depressiven Symptomen, weil diese Autonomiebedürfnisse ja verzerrt werden. Sie zeigen sich, sollen aber bitte schön nicht da sein.
Dieses neu erwachte (und nicht akzeptierte) Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Autonomie bringt das Leben durcheinander und kann in eine Depression münden. Es wahrzunehmen, zu akzeptieren und vorsichtig in das Selbstkonzept zu integrieren ist dann Aufgabe der Therapie.
Bis jetzt haben wir hier ein idealtypisches Bild von depressiven Klienten gezeichnet, in das sich natürlich nicht alle einfügen lassen. Vor allem können sich die beiden Pole der Diskrepanz auch komplett umdrehen: So kann es auch sein, dass im Selbstkonzept das Autonomiebedürfnis fest verankert ist und sich die Klientin als selbstbestimmt und unabhängig erlebt. Vom Bewusstsein ausgeschlossen sind jedoch ihre Bedürfnisse nach Geborgenheit, warmherziger Zuwendung und Beachtung. So etwas wie Abhängigkeit von jemand anderem wird abgewehrt, um auf Biegen und Brechen die Autonomie aufrechterhalten zu können und das Gefühl von Kontrolle oder Dominanz in Partnerbeziehungen. Dieses Autonomie-Erleben ist aber stets vom Zusammenbruch bedroht, wenn der Partner Anhänglichkeit und Gefolgschaft auch nur ansatzweise verweigert.
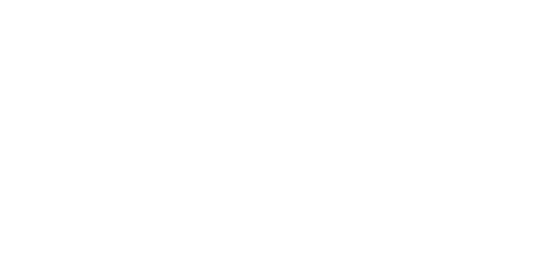


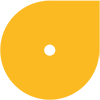 Mitglied in der Gesellschaft für Personzentrierte Psychotherapie und Beratung e.V.
Mitglied in der Gesellschaft für Personzentrierte Psychotherapie und Beratung e.V.